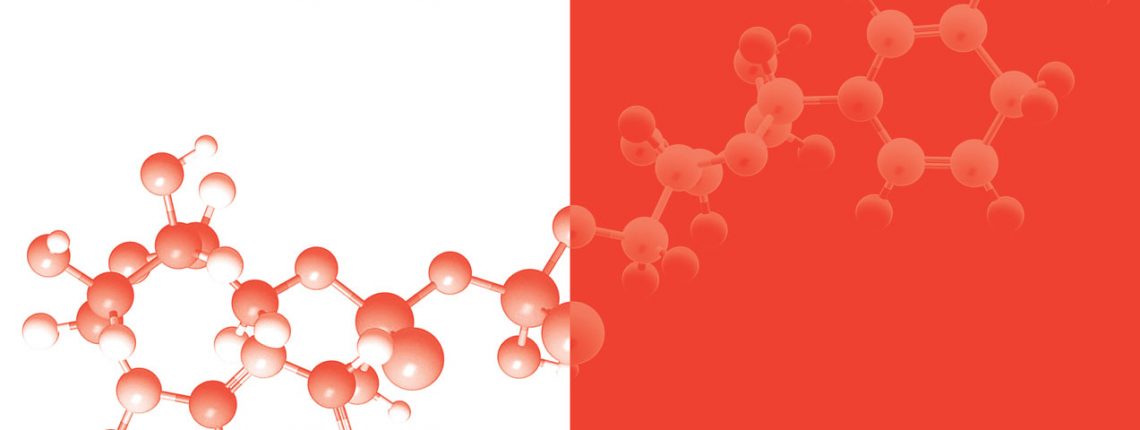
Chemie Die unsichtbare Gefahr
Mikroskopisch kleine Plastikteilchen sind in der Umwelt fast überall zu finden. Ein Problem, das sich vielleicht lindern lässt: mit maßgeschneiderten Biokunststoffen. Für ihre Herstellung bedarf es umweltfreundlicher und hoch spezialisierter Katalysatoren
Wer gerne wandert, ärgert sich immer wieder über den Müll: angefangen bei kleinen Bonbonpapierchen und Zigarettenstummeln über Keksverpackungen und Chipstüten bis hin zu Elektroschrott. Das ist nicht nur ästhetisch abstoßend, die Kunststoffe sind in der Regel biologisch nicht abbaubar und bleiben der Umwelt über lange Zeit erhalten. Die einfachste, wenn auch nicht von allen begriffene Lösung: Plastikmüll sollte immer in unserem Entsorgungssystem landen, das sich darum kümmert, dass er recycelt, verbrannt oder zumindest sicher deponiert wird.
Neben den großen Abfällen, die sich zumindest theoretisch leicht wieder entfernen lassen, gibt es in der Umwelt aber auch sogenanntes Mikroplastik, das wir mit bloßem Auge nicht sehen können. Es entsteht durch mechanische Zerkleinerung – zum Beispiel, wenn ein kräftiger Windstoß eine Verpackung gegen einen Baum schlägt. Zusätzlich wird Mikroplastik auch durch unsere alltäglichen Handlungen in die Natur eingetragen: Beim Waschen von Kleidung lösen sich kleine Fasern, die nicht alle in der Kläranlage herausgefiltert werden. Unsere Schuhsohlen reiben sich mit der Zeit ab und verteilen sich auf den Gehwegen. Nicht zuletzt muss der Kunstrasenplatz regelmäßig erneuert werden, weil er seine Plastikhalme verliert.
Nur weil die Plastikpartikel klein und unsichtbar sind, heißt das nicht, dass sie keinen Schaden anrichten. Es ist noch nicht abschließend geklärt, wie gefährlich Mikroplastik ist, aber Studien zeigen, dass es sich im Gewebe und Gehirn absetzt. Dafür, dass diese Partikel nur wenig untersucht sind, haben sie sich mittlerweile aber überall verbreitet: Der Wind trägt sie auf die höchsten Berge, und über Flüsse und Strömungen treiben sie bis in die Tiefsee.

Das in der Umwelt bereits vorhandene Mikroplastik werden wir nicht mehr zurückholen können, aber wir können dafür sorgen, dass es in Zukunft nicht noch mehr wird. Alle Produkte, die allein durch ihre Nutzung feinste Plastikteilchen freisetzen – zum Beispiel Schuhsohlen oder Autoreifen –, sollten aus biologisch abbaubaren Materialien bestehen. Die meisten Kunststoffe werden aus Erdöl hergestellt, und obwohl das Material selbst mehrere Jahrhunderte stabil ist, wird es oft nur wenige Monate verwendet und dann zum Problem.
Biokunststoffe hingegen werden entweder aus Biomasse produziert oder sind innerhalb von Monaten biologisch abbaubar. Im Optimalfall erfüllen sie beide Kriterien – so wie Polylactid, kurz: PLA. Dieser Biokunststoff wird schon in großem Maßstab hergestellt und ersetzt herkömmliche Kunststoffe bereits in einer Reihe von Anwendungen.
Jedoch können Kunststoffe stark unterschiedliche Eigenschaften besitzen: von der flexiblen Frischhaltefolie, die wir in der Küche benutzen, bis hin zur harten Armatur im Auto. Biologisch abbaubare Kunststoffe zu entwickeln, die diese Bandbreite an Eigenschaften abdecken, ist eine große Herausforderung.
Um zu verstehen, wovon die Eigenschaften eines Kunststoffes abhängen, lohnt ein Blick auf ihren inneren Aufbau. Auf molekularer Ebene bestehen sie aus Gebilden, die wie Perlenketten aufgebaut sind. Die Perlen werden Monomere genannt und die Kette Polymer. Viele Polymerketten zusammen ergeben das, was wir als Kunststoff kennen. Je nachdem, welche chemische Zusammensetzung die Perlen haben und in welcher Weise sie zu einer Kette verknüpft sind, hat der Kunststoff verschiedene Eigenschaften.
Für die Herstellung eines Kunststoffes – für das Auffädeln der Perlen also – benötigt man ein besonderes Molekül, das oftmals ein Metall beinhaltet. Dieser „Katalysator” aktiviert eine dafür vorgesehene Stelle an der Perle, eine Funktionalität, um die Perle auffädeln zu können. Den Prozess des Aneinanderreihens der Perlen durch den Katalysator nennt man Polymerisation.
Die Beschaffenheit des Katalysators spielt eine große Rolle für eine Polymerisation, da die Funktionalität der Perlen und des Katalysators aufeinander abgestimmt sein müssen. Deswegen werden Katalysatoren für Polymerisationen lange optimiert, bis sie zur Kunststoffherstellung eingesetzt werden können. Im Fall des vielversprechenden Biokunststoffes PLA kommt industriell ein giftiger Schwermetallkatalysator zum Einsatz, weil er die besten Polymerisationseigenschaften zeigt. Er ist zugelassen, weil er nur in kleinen Mengen eingesetzt wird. Da er aber im Kunststoff verbleibt, kann sich das Schwermetall in Ökosystemen anreichern. Kurzum: Anstelle des nicht abbaubaren Mikroplastiks gelangt nun ein giftiges Schwermetall in die Umwelt.
Im Rahmen meiner Arbeit wollte ich daher zunächst einen Katalysator entwickeln, der mindestens genauso schnell arbeitet wie sein schwermetallhaltiges Pendant. Er sollte aus Eisen bestehen und somit der Umwelt nicht schaden. Tatsächlich ist das unserem Team gelungen. Unser Katalysator arbeitet sogar noch schneller und ist somit ein aussichtsreicher Bewerber für die Herstellung von PLA in großem Maßstab.
Er ist nicht nur schnell, sondern auch flexibel einsetzbar. Üblicherweise sind Katalysatoren auf Perlen mit einer bestimmten Funktionalität spezialisiert. Nicht aber unser neuer Eisenkatalysator: Er kann verschiedene Funktionalitäten zum Verknüpfen nutzen und ermöglicht so Kombinationen und dementsprechend Kunststoffeigenschaften, die sonst nicht in einer Reaktion denkbar wären.
Neben dem Anteil der einzelnen Perlen in der Polymerkette ist auch deren Anordnung wichtig: Es macht einen großen Unterschied für die Eigenschaften, ob erst „blaue” Perlen in der Kette vorkommen, dann „gelbe” und schlussendlich „rote” oder ob alle Perlen bunt verteilt entlang der Kette zu finden sind. Katalysatoren präferieren oft eine bestimmte Perlenart, fädeln diese zuerst auf und dann mit abnehmender Präferenz die anderen. Für eine bunt gemischte Kette wäre es also notwendig, dass der Katalysator keine Perlen bevorzugt. Das ist sehr selten.
Wir konnten jedoch zeigen, dass es noch einen anderen Weg gibt. Auch unser Katalysator hat Präferenzen für gewisse Perlen und baut sie in der entsprechenden Reihenfolge ein. Erhöht man jedoch die Temperatur, fädelt er die Perlen nicht mehr geordnet nach seiner Präferenz auf, sondern bricht die schon hergestellte Kette einfach an einer Stelle auf, fügt eine Perle ein und verschließt sie wieder mit einem anderen Kettenende. Das macht er so lange, bis er bunt gemischte Ketten hergestellt hat. Der Katalysator kann demnach abhängig von der Temperatur farblich sortierte oder bunt gemischte Ketten herstellen, was die Kunststoffproduktion vereinfacht. Der umweltfreundliche Eisenkatalysator ist also nicht nur für die Herstellung von PLA einsetzbar, sondern auch für andere Biokunststoffe mit variablen Zusammensetzungen und damit Eigenschaften. Durch die Verfügbarkeit dieser biologisch abbaubaren Materialien können herkömmliche Kunststoffe in Alltagsgegenständen ersetzt werden. Auf diese Weise ließe sich die Menge von potenziell gefährlichem Mikroplastik in der Umwelt deutlich verringern.
Zum Thema
Jede Woche eine Kreditkarte
Jeder von uns isst im Schnitt mehr als ein halbes Pfund Plastik im Jahr. Guten Appetit!
„Es ist so traurig”, sagte Alex Aves kürzlich. „Dass wir im frischen Schnee der Antarktis Mikroplastik gefunden haben, zeigt das Ausmaß der weltweiten Plastikverschmutzung.” Die Forscherin der neuseeländischen Canterbury University bestätigt damit, was viele Expert:innen lange befürchteten: Nicht die Frage „Wo findet sich Plastik in der Umwelt” ist die richtige, sondern: „Wo findet es sich nicht?”.
Längst haben Kunststoffe ihren Weg auch in die Nahrungsketten gefunden. Und zwar in Gestalt von Nano- bis Mikrometer kleinen Teilchen. In Fischen, Seehunden, Vögeln – und natürlich auch Menschen – wurde sogenanntes Mikroplastik nachgewiesen. Ob wir essen, trinken oder atmen: In jeder Sekunde nehmen wir Plastik zu uns.
Nach der Auswertung von 26 Studien schätzt ein Team um Kieran Cox von der kanadischen University of Victoria, dass wir je nach Alter und Geschlecht pro Jahr 74.000 bis 121.000 Mikroplastikpartikel aufnehmen. Umgerechnet entspricht das einer Kunststoffmenge von rund fünf Gramm pro Woche. Ungefähr so viel wiegt eine Kreditkarte. Wer die täglich empfohlenen zwei Liter Wasser lediglich aus Plastikflaschen trinkt, nimmt allein auf diese Weise pro Jahr rund 90.000 zusätzliche Plastikpartikel auf.
Welche gesundheitlichen Auswirkungen diese Fremdstoffe haben, ist noch unklar. In einer Übersichtsstudie kamen Elisabeth Gruber und Lukas Kenner von der Medizinischen Universität Wien aber gerade erst zu dem Schluss, dass die mikroskopisch kleinen Plastikpartikel im Magen-Darm-Trakt zu Entzündungs- und Immunreaktionen führen können. Die kleinste Fraktion – die Nanokunststoffe – werden überdies mit biochemischen Vorgängen in Verbindung gebracht, die entscheidend an der Krebsentstehung beteiligt sind.
— JS

